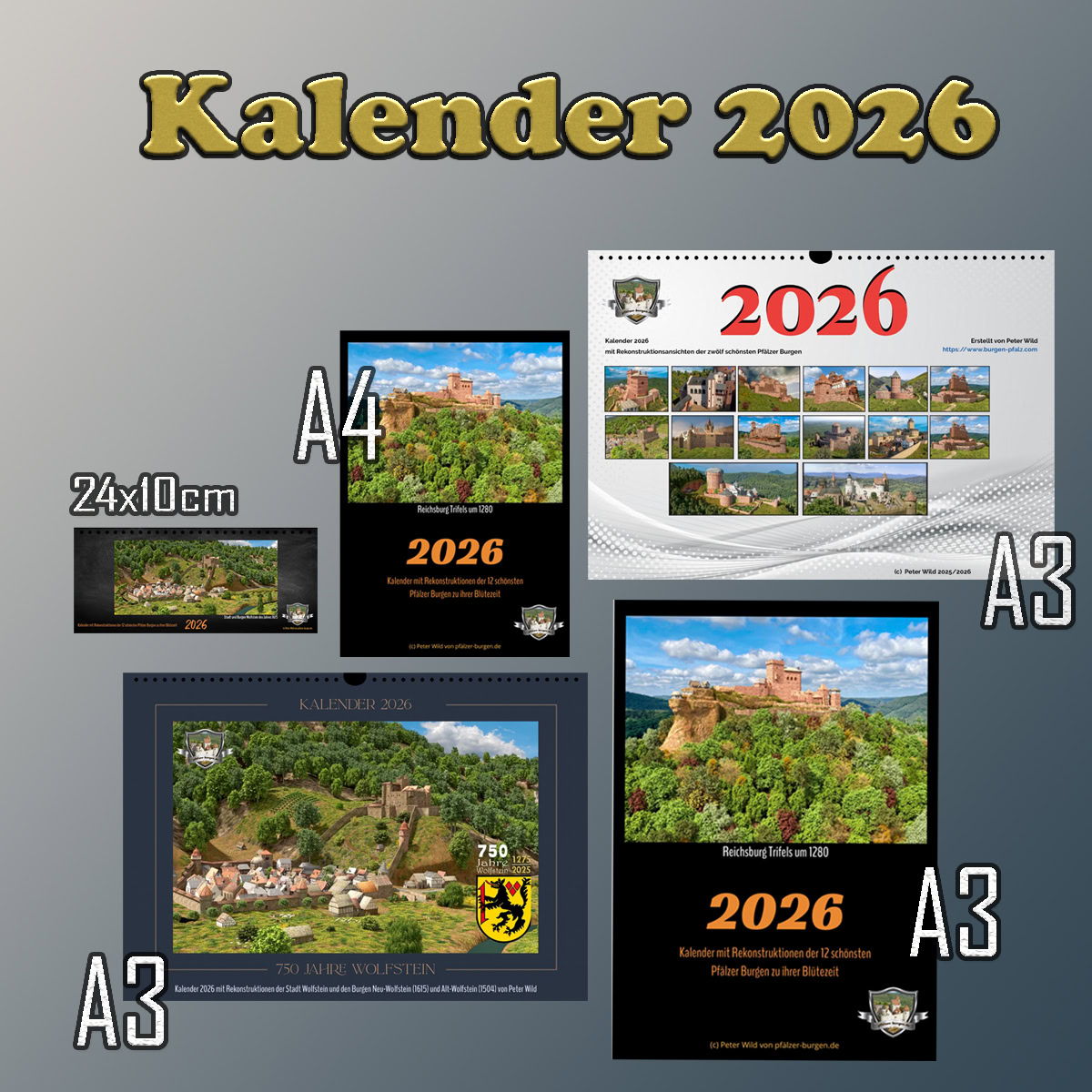Wehrkonzeption der Burg Landeck
Überblick
 Die Burg Landeck wurde um die Wende des 12. zum 13. Jahrhundert erbaut. Als Burgenplatz wurde ein Bergsporn oberhalb des Klingbachtales und des Klosters Klingenmünster gewählt. Diese Lage mit steil abfallenden Berghängen zur Süd-, Ost- und Westseite gestatteten eine Feindannäherung nur aus Norden. Folglich befinden sich die Hauptbefestigungen allesamt an der Nordseite.
Die Burg Landeck wurde um die Wende des 12. zum 13. Jahrhundert erbaut. Als Burgenplatz wurde ein Bergsporn oberhalb des Klingbachtales und des Klosters Klingenmünster gewählt. Diese Lage mit steil abfallenden Berghängen zur Süd-, Ost- und Westseite gestatteten eine Feindannäherung nur aus Norden. Folglich befinden sich die Hauptbefestigungen allesamt an der Nordseite.
 Mit dem Aufkommen von Pulverwaffen wurde die stauferzeitliche Kernburg durch einen umlaufenden Zwinger und ein Vorwerk verstärkt. Das heutige Antlitz der Burg entwickelte sich also erst im 15. Jahrhundert. Hierbei wurde das Gelände zwischen Kernburg und Zwingermauern aufgefüllt und das Niveau im Bereich des Vorwerks terrassenartig nivelliert. Die Burgenforschung geht davon aus, dass sich erst dardurch die heutige Gestalt des Halsgrabens, dessen Überbrückung und der Bau des Brückenturms ergaben. Ein im Burgmuseum ausgestelltes Modell zeigt das mögliche Aussehen der stauferzeitlichen Burganlage als Kontrast.
Mit dem Aufkommen von Pulverwaffen wurde die stauferzeitliche Kernburg durch einen umlaufenden Zwinger und ein Vorwerk verstärkt. Das heutige Antlitz der Burg entwickelte sich also erst im 15. Jahrhundert. Hierbei wurde das Gelände zwischen Kernburg und Zwingermauern aufgefüllt und das Niveau im Bereich des Vorwerks terrassenartig nivelliert. Die Burgenforschung geht davon aus, dass sich erst dardurch die heutige Gestalt des Halsgrabens, dessen Überbrückung und der Bau des Brückenturms ergaben. Ein im Burgmuseum ausgestelltes Modell zeigt das mögliche Aussehen der stauferzeitlichen Burganlage als Kontrast.
Burgweg
 Die Geländeform gestattete es dem Burgherrn nicht, den Burgzugang in der feindabgewandten Burgseite zu platzieren, so wie auf Burg Gräfenstein, Neuscharfeneck oder dem Trifels zu sehen, wo man erst einmal die halbe Burg umrunden musste, bevor man das Haupttor erreichte. Der Zugang zur Kernburg auf Landeck musste folglich durch andere fortifikatorische Maßnahmen erreicht werden. Der Weg zur Burg führte vermutlich entlang des ansteigenden Bergkamms, wo heute die kleine Zubringerstraße verläuft.
Die Geländeform gestattete es dem Burgherrn nicht, den Burgzugang in der feindabgewandten Burgseite zu platzieren, so wie auf Burg Gräfenstein, Neuscharfeneck oder dem Trifels zu sehen, wo man erst einmal die halbe Burg umrunden musste, bevor man das Haupttor erreichte. Der Zugang zur Kernburg auf Landeck musste folglich durch andere fortifikatorische Maßnahmen erreicht werden. Der Weg zur Burg führte vermutlich entlang des ansteigenden Bergkamms, wo heute die kleine Zubringerstraße verläuft.
Der stauferzeitliche Burgzugang


Das Vorwerk aus dem 15. Jh und der Brückenturm


Der Hohe Mantel

Der Mauer ist ungefähr 2m stark und 10m hoch. Sie trug sicherlich einen überdachten Wehrgang über einem Zinnenkranz.
Die Toranlage
Wie oben dargelegt, befindet sich der Hauptzugang zur Burg in der Frontseite. Zwei bautechnische Besonderheiten sind anzusprechen:
- Das Haupttor ist bis zur Mauerkrone nischenartig eingezogen, was den Bau von Flankierungstürmen verzichtbar machte.
- Der Weg vom Brückenturm zum Haupttor verläuft nicht geradlinig, sondern über Eck. Hierdurch war das Heranschieben schwereren Belagerungsgerätes nicht mehr möglich.

Der Bergfried

Schmuckstück der Burganlage ist der sehr gut erhaltene, nahezu rechteckige, und heute noch 23m hohe Bergfried. Dessen Seitenkante ist in die Hauptangriffsrichtung gedreht, um auf die Burg abgeschossene Blidensteine zur Seite abzulenken.
Der einzige Zugang in den Bergfried führte über eine auf der Hofseite in 10m Höhe liegende Pforte, zu der man über eine im Krisenfall abschlagbare Holztreppe gelangte. Der heutige genutzte Zugang auf der Zwingerseite ist nachträglich durchgebrochen.
Außer der Tür und einigen Lüftungsschlitzen gibt es keine Öffnungen in dem massiven Baukörper. Das Untergeschoss wurde möglicherweise als Verlies, wahrscheinlicher – so wie heute – als Vorratsraum genutzt.
Buckelquadermauerwerk als Machtsymbol
Zur Feldseite wurde sehr repräsentatives Buckelquadermauerwerk verbaut, welches wir heute noch am Bergfried und an den Außenmauern des Hohen Mantels und des Brückenturms bewundern können. Diese kostspielige Art der Steinbearbeitung zeugte von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Burgherrn und symbolisiert dessen Macht, Reichtum und militärische Potenz.
Wehrmauern und Schießscharten
Die Wehrmauern der stauferzeitlichen Burg (Bering) waren mit Zinnen versehen und mit überdachten Wehrgängen bekrönt. Sie boten dem Verteidiger Schutz im Feindfeuer und Pfeilhagel.

Schießscharten finden wir nicht im Bering und auch nicht im Hohen Mantel, sondern nur in den vorgelagerten Zwingertürmen, die nach 1416 der Kernanlage hinzugefügt wurden. Die Schlüsselscharten dort haben unten eine Spatenform und sind tauglich für Handfeuerwaffen (Hakenbüchsen) oder für Armbrüste. Der Abstand zwischen den Zwingertürmen beträgt max. 25m, so dass sowohl mit Armbrust und erst recht mit einer Hakenbüchse von Turm zu Turm und im Kreuzfeuer gewirkt werden konnte. So wurden tote Räume im Schussfeld vermieden.
Das Waffeninventar
Der Zwinger
Die Wasserversorgung
 Ein Burgbrunnen in der Kernanlage von Landeck konnte nicht nachgewiesen werden. In unmittelbarer Nähe befindet sich am Ostende des Halsgrabens eine durch ein Sandsteingewölbe geschützte Wasserstelle. Da diese aber außerhalb der Kernburg liegt, hatte sie für die Wasserversorgung während einer Belagerung keinen Nutzen. In Friedenszeiten konnte das Wasser aus weiteren nahegelegenen Quellen mit Wassereseln mühelos herangeführt werden. Und so ist die 8 x 8m große Filterzisterne mit einer Entnahmeröhre die einzige nachgewiesene Wasserstelle in der Burg. Im Belagerungsfall wäre die Stützung der Versorgung auf nur eine Zisterne schnell zum kritischen Versorgungsengpass geworden..
Ein Burgbrunnen in der Kernanlage von Landeck konnte nicht nachgewiesen werden. In unmittelbarer Nähe befindet sich am Ostende des Halsgrabens eine durch ein Sandsteingewölbe geschützte Wasserstelle. Da diese aber außerhalb der Kernburg liegt, hatte sie für die Wasserversorgung während einer Belagerung keinen Nutzen. In Friedenszeiten konnte das Wasser aus weiteren nahegelegenen Quellen mit Wassereseln mühelos herangeführt werden. Und so ist die 8 x 8m große Filterzisterne mit einer Entnahmeröhre die einzige nachgewiesene Wasserstelle in der Burg. Im Belagerungsfall wäre die Stützung der Versorgung auf nur eine Zisterne schnell zum kritischen Versorgungsengpass geworden..